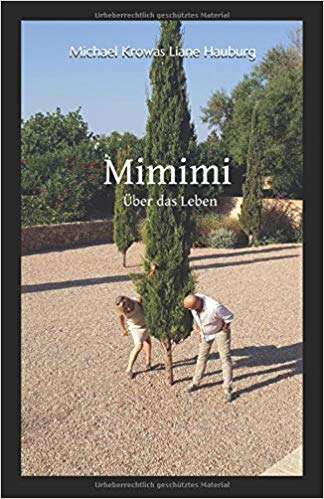Was also schreibt man über das Konzert eines Mannes, der seit Jahrzehnten zur Crème de la crème der Jazz- und Funkbassisten gehört? Der mit allen, wirklich allen Größen der verschiedenen Genres auf den Bühnen dieser Welt konzertiert hat? Der vierfacher Grammy-Preisträger ist? Der jetzt im Pavillon eins von nur drei Konzerten in Deutschland gespielt hat? Stanley Clarke. Der Name allein lässt Jazz-Enthusiasten in aller Welt heute wie damals vor Ehrfurcht niederknien. Was schreibt man, das nicht schon tausendmal geschrieben worden ist? Chick Corea, Stan Getz, George Duke, Dexter Gordon, Art Blakey - sie alle gehören zu den Weggefährten des 64-jährigen Bassisten aus Philadelphia. Der Filmen wie "The Transporter" und "Romeo must die" seinen musikalischen Stempel aufgedrückt hat. Am Samstag war er mit seiner aktuellen Band zu Gast in Hannover, eingeladen auf Initiative eines Musikverrückten. Gerd Kespohl, Mastermind im Pavillon, quillt der Stolz auf den Gast aus jeder Faser, als er mit bebender Stimme: "Stanley Clarke, der beste Bassmann der Welt" ankündigt. Ein weiterer Weggefährte Clarkes, der Drummer Gerry Brown, konzertiert am selben Tag im Lindener Jazzclub - die Welt ist ein Dorf. In den Jazzclub passen knapp 100 Zuhörer, im Pavillon waren es einige mehr: Rund 600 Gäste wollten die, Verzeihung, Legende, hören.
Was sie zu sehen bekommen, ist ein gewaltiger Verstärkerturm in der Mitte der Bühne, ein Flügel links und ein Schlagzeugungetüm rechts. Davor zwei Keyboard-Konglomerate unterschiedlicher Marken. Dann betreten die vier Musiker des Abends die Bühne. Erwartungsvolles Raunen im Publikum, Bassspieler sind reichlich da, Die zopftragenden Jazz-Freaks, Fusion-Nerds und Funk-Fans sind allesamt älteren Semesters. sie wollen hören, was die, Verzeihung, Legende, heute noch zu bieten hat. Und in Erinnerungen schwelgen an eine Zeit, als Afro-Look noch Afro-Look heißen durfte, als Earth. Wind & Fire als das Maß aller Disco-Dinge galten und als Mark King von Level 42 das Bassspiel salonfähig gemacht hat. Clarke, mit Sonnenbrille, schlendert ans Mikrofon, hängt sich sein Arbeitsgerät um, begrüßt mit breitem Grinsen die jetzt schon jubelnden Gäste und legt los - die Sonne steht tief im Pavillon, als er die ersten Töne spielt. Das zweite Stück ist von Charles Mingus, einer Free-Jazz-Legende, und macht klar, dass es kein einfacher Abend werden wird. Clarke spielt dezent, hält sich zurück, macht seinen Mitstreitern auf der Bühne viel Platz. Sein Bass hat diesen eigentümlich schwebenden Ton, der unter hunderten Bassisten erkannt wird. Wie Pat Methenys Gitarre klingt es, wenn er plötzlich ausbricht, irrsinnig schnelle 32stel-Noten spielt, um danach wieder mit nur wenigen Tönen das Gerüst für die Improvisationen der Anderen zu bauen. Dann stellt er die Band vor. Der 20-jährige Beka Gochiashvili spielt auf einem Yamaha-Keyboard und auf dem Grotrian-Steinweg-Flügel, der 21-jährige Drummer heißt Mike Mitchell, Cameron Graves, der zweite Keyboarder hinter Korg und Roland ist dreißig, "and I am Louis Armstrong", scherzt die, Verzeihung, Legende. Die Küken von Papa Clarke grinsen sich eins.
Mitchell wütet hinter seinen Trommeln, er hat eine zusätzliche Snare aufgebaut, die ein eigenes Effektgerät hat. Von Zeit zu Zeit führt ein Schlag auf das Fell zu fast schmerzhaft lauten Echotönen. Auch Handclaps kann diese Snare erzeugen - die allerdings irritieren, weil sie allzu synthetisch klingen. Vorn sitzt der Chef inzwischen auf einem Barhocker hinter Kontrabass, und macht auch damit eine gute Figur. Nur von Mitchells treibendem Groove begleitet, baut er das Gerüst weiter in die Höhe. Mit geslaptem Bass und Pizzicati, Obertönen und perkussiven Schlägen auf den Korpus entsteht minutenschnell ein Hochhaus. Clarke beherrscht das Kunststück, jedes Stück anders klingen zu lassen. Oft reicht ihm die Andeutung eines Tons, manchmal explodiert er auch hinter seinem Bass. Samba und Bossa-Nova, Calypso und Blues werden in feinsten Jazz-Kabinettstückchen vereint, der pfeifende Minimoog-Sound von Graves, das dschungelartige Rhythmusfundament von Mitchell erzeugen Begeisterungsstürme im durchweg fachkundigen Publikum. Die eigentliche Entdeckung des Abends ist aber Gochiashvili. Im Stile eines Michel Petrucciani fegt er wie ein Derwisch über die Tasten, es entwickeln sich unglaubliche Dialoge zwischen Clarkes Bass und seinem Klavier, Oft wartet Papa Clarke geduldig auf seinem Hocker in der Mitte, bis seine Jungs fertig mit ihrem Gedaddel sind und sich ihren wohlverdienten Applaus abgeholt haben, bis er wieder übernimmt. Zart wie Schmetterlingsflügel sind manche der Themen, die er vorgibt, brachial wie Presslufthämmer enden sie. Atemlose Erleichterung im Publikum, Jubel, Füßetrampeln.
Für einige Zuschauer scheint das alles zuviel zu sein, sie ignorieren die Bitte von Gerd Kespohl, man möge doch die Handys ausschalten und nicht fotografieren. Rein und raus geht's im Pavillon, man pfeift auf die leisen Passagen, geht ungeniert vor der Bühne vorbei. Clarke blickt zeitweilig irritiert, aber er ist zu sehr Profi, um sich von undisziplinierten Gästen stören zu lassen. Am Ende hängt er sich wieder den E-Bass um und geht auf Zeitreise: Den geslapten Bass hat er als einer der ersten so gespielt, damals, als er mit George Duke Songs wie "Loui Loui" oder "Sweet Baby" augenzwinkernd tanztauglich gemacht hat. Nach zwei Stunden ist eins der abwechslungsreichsten Konzerte im Pavillon vorbei, und die Besucher gehen beseelt ihrer Wege, in dem Bewusstsein, eine, Verzeihung, Legende erlebt zu haben.