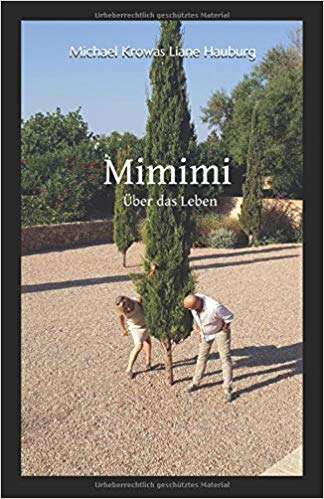Markus Becker: Freistil. Eine Lobhudelei.
Eine Tonaufnahme von 1975 ist heute noch der Maßstab. Pianisten, die sich an ein Improvisationsalbum heran trauen, werden immer an „The Köln Concert“ von Keith Jarrett gemessen werden, egal, ob sie es darauf anlegen oder nicht. Markus Becker legt es nicht darauf an. Der Klavierspieler hat in den inzwischen mehr als 30 Jahren seiner Karriere eine eindrucksvolle Vita vorzuweisen. Allein dreimal hat er den Echo erhalten, eine der höchsten Auszeichnungen, die das klassische Genre zu vergeben hat – den ersten im zarten Alter von 24 Jahren. Seit 1993 hat er eine Klavierprofessur an der Musikhochschule Hannover inne. Seine umfangreichen Max-Reger-Einspielungen gelten weltweit als das Maß aller Dinge. Nein, Becker muss wirklich nichts mehr beweisen. Jetzt hat er sich den Luxus gegönnt, die sicheren Pfade der Interpretation fremden Materials zu verlassen. Sein Album „Freistil“ ist ein Kleinod der Klaviermusik, ein liebevoll zusammen gestelltes Sammelsurium aus Stilen und Melodien, das entspannte Werk eines großen Pianisten. Dabei hat „Freistil“ eine große Leichtigkeit; wie dahin geworfen wirken einzelne Stellen – denn genau das sind sie auch. Becker hat in den drei Tagen, die er im Bremer Sendesaal hinter einem Steinway verbracht hat, improvisiert. Nicht mehr. Und nicht weniger.
Ja, Hannover wieder. Hannover hat eine Reihe hervorragender Musiker in den unterschiedlichsten Genres hervorgebracht. Thomas Quasthoff ist als Sänger sogar mit zwei Grammys ausgezeichnet worden. Er hat die klassische Musik ad acta gelegt und widmet sich jetzt ausschließlich dem Jazz, seiner großen Leidenschaft. Auch Becker kommt vom Jazz. Jeder, der ihn damals im Proberaum im Zooviertel erlebt hat, hat danach vermutlich doppelt so viel geübt, um verzweifelt festzustellen, dass es trotzdem nicht reicht, auch nur annähernd der schwebenden Leichtigkeit von Markus Becker nahe zu kommen. In der Stadt gibt es weitere Ausnahmepianisten: Igor Levit, Elmar Braß, Achim Kück oder Lutz Krajenski spielen in einer eigenen Liga. Im Popmusikbereich der UNESCO City of Music braucht man keine Namen zu nennen; die Assoziationen sind stets präsent. Und jetzt kommt der Ur-Hannoveraner Becker, der durchaus in einem Atemzug mit Lang Lang oder mit Yiruma genannt wird, und ausgerechnet die Institution in Sachen Klassik liefert ein Album ab, mit dem man nicht gerechnet hätte. Und das einem das Lächeln tief ins Gesicht meißelt. Und schließlich: Irgendwo muss man ja geboren worden sein. Niemanden interessiert das außerhalb der betreffenden Stadt. Sängerin Nicole steht im Goldenen Buch der Stadt Saarbrücken, Lena Meyer-Landrut steht im Goldenen Buch von Hannover, Beckers Unterschrift sucht man dort vergebens. So what. Aber:
Was Becker in die Königsklasse von Jarrett, von Michel Petrucciani oder von Dave Grusin hebt, ist die Qualität der Lieder, die in den drei Tagen in Bremen entstanden sind. Auf Jarretts Album sind es vier Stücke, die er stöhnend und schwitzend in der Kölner Oper gespielt hat – auf Beckers „Freistil“ sind es neunzehn! kleine und größere Themen. Was der kleine große Petrucciani oft mit mathematischer Präzision gespielt hat, klingt bei Becker wie eine gelöste Gleichung mit teilweise überraschendem Ergebnis. Wo Grusin Gefahr läuft, seine komplizierten Stücke mit allzu süßem Zuckerguss zu überziehen, achtet Becker darauf, seine akustischen Gedankenhäppchen von vorn herein nicht zu schwer und dadurch ungenießbar werden zu lassen.
Auf dem Klappcover der CD beschreibt Markus Becker selbst seine Arbeit am Klavier und an dem Tonträger, wie es niemand besser hätte tun können. Wer wüsste mehr als der Künstler selbst zu den Stücken zu sagen. Dabei ist er weit entfernt von jeglicher Phrasendrescherei. Das gilt auch für die Musik: Zurückhaltung statt Selbstbeweihräucherung – „Freistil“ zeigt genau das, was geniale Musiker aller Stile und aller Epochen ausmacht: Alles, was man je gelernt hat, unhörbar zu machen und dadurch eine Authentizität zu erreichen, die es verbietet, Können oder Technik oder Schnelligkeit oder Kompositionskunst zu bewerten. Es sind allein die Töne, die zählen. Die Gefühle vermitteln.
Markus Becker sagt sehr persönlich, was er bei den einzelnen Stücken für Assoziationen hatte. Doch beim Hören seiner dahingetupften Melodien entstehen eigene Gefühle, die sehr oft nichts mit den Beckerschen Empfindungen zu tun haben. Ein vermessener Vergleich: Millionen von Beatles-Fans halten deren weißes Album für das beste der Welt. Die Gefühle eines jeden Einzelnen beim Hören der Schallplatte sind trotzdem völlig unterschiedlich. Jegliche Kritik kann demnach nur persönlich sein; es steht dem Rezensenten nicht zu, über instrumentale Fertigkeiten eines Virtuosen zu urteilen. Aber es steht ihm zu, seine Empfindungen und Gedankenketten zu beschreiben. Deswegen das Folgende:
Becker hat sein erstes Stück „Vernissage“ genannt. Mehr Jarrett geht nicht. Man hört Blues, man hört versöhnliche Harmonien, auf dem dunklen Thema liegen spielerische erhellende Singlenotes. Ich denke an eine Leiter, manche Stufen erklimme ich vorsichtig, auf manchen stehe ich sicher. Wohin führt sie?
„Abzählreim“, das zweite Stück, lässt vieles im Unklaren und hört überraschend auf. Zur Versöhnung gibt es danach in „Keller Küche“ ein wenig Gershwin zum Wohlfühlen. Becker gelingt das Kunststück, eine vieltausendmal gehörte Blues-Endphrase durch eine simple Drehung völlig neu klingen zu lassen.
„Nostalgia“ führt mich in ein rosafarbenes Schlafzimmer der 50er Jahre. Wo ist Doris Day, wenn man sie braucht?
„oder so“ – das Stück, das Jazz am Nächsten kommt. Die Vermutung lag nahe, als Becker eine Impro-CD angekündigt hatte, dass es Jazz-Spielereien werden. Nun, Jazz ist das alles nicht, auch wenn die Genre-Definition in den vergangenen Dekaden aufgelockert worden ist. Es ist meditativ, zart, kompliziert und fordert die ganze Konzentration, aber Jazz? Man korrigiere mich, aber: Nein.
„Zwielicht“ – sparsamer Anfang. Vielleicht das aufschlussreichste Lied, denn man hört die gesamte klangliche Bandbreite des Flügels. Oben jubilieren die Perlenketten, unten droht der Bass. Die Vereinigung macht atemlos.
„Kinderszene“ – eindeutig ein Wiegenlied. Hier stimmen meine Gedanken mit denen Beckers überein. Gruß an Robert Schumann.
Bevor ich „Prozession“ gehört habe, habe ich Beckers eigene Beschreibung gelesen. Fehler. Die Bilder, die er in meinen Kopf gepflanzt hat, lassen sich nur schwer wieder löschen. Ich kann bestenfalls meine Assoziation hinzufügen: James Bond, Leben und Sterben lassen. Südstaaten, Voodoo. Ich lasse das mit dem Vorher-Lesen künftig sein.
„Regen Regen“ ist mein persönliches Lieblingsstück. Zunächst war es nur „Lied neun“ im Auto – Sie kennen das. Dann wurde das fragile Stückchen immer eindringlicher. Es soll bitte nie aufhören …
Bei „Paarlauf“ höre ich in den Doppeltönen wieder Keith Jarrett. Becker sagt dazu, er war nie besonders gut auf dem Eis am Pferdeturm. Dafür war er erfolgreich im Knabenchor Hannover. Man kann nicht alles haben.
Becker schreibt über „Spieglein“, dass seine Finger kurz vor dem Verknoten waren. Meine Finger verknoten sich ab und zu schon bei G-Dur. Na und? Mit einem Knoten im Finger geh ich noch lange nicht nach Hause. Hauptsache, die Töne haben die gewünschte Wirkung. Dissonanzen, aber im Gegensatz zu Stockhausen setzt Becker einen Punkt ans Ende, so dass man ausatmen und sich auf „Nachruf“ freuen kann. Becker sagt, er werde versuchen, die improvisierten Harmonien genau heraus zu hören, damit er sie bei seinen Konzerten genau so wiedergeben kann. Ich nehme an, das stellt sein Ensemble vor ziemliche Herausforderungen, denn das Stück ist in Ges-Dur. Und ich denke die ganze Zeit an Silvester. „Should Auld Acquaintance Be Forgot“ …
„Pilotfisch“ ist ein tropfender Wasserhahn. Eiin Klempner fummelt herum und repariert ihn. Ein sehr hibbeliger Klempner …
„Daumenkino“ – verstörend, á la Schönberg, aber es verhindert, dass man in einen sanften Wohlgefühlschlummer fällt.
„Dvořák“ – in Anlehnung an den New York-Aufenthalt des tschechischen Komponisten. Das Stück allerdings klingt wie Südstaaten. Schwül, träge, Mississippi, Ragtime. Und New Orleans ist ja nur 2000 Kilometer von New York entfernt …
Bei „Elchtest“ tut die linke Hand so, als hätte sie nichts zu tun, während die rechte um sie herum scharwenzelt. Dann darf sie doch noch zeigen, das sie mehr kann als Terzen spielen.
„Barcarole“ hat nichts mit Offenbachscher Operette zu tun. Der Titel ist gut gewählt, denn man wähnt sich auf einem Fluss. Wobei der venezianische Gondoliere eher martialisch daher kommt.
Ja, Hannover wieder. Hannover hat eine Reihe hervorragender Musiker in den unterschiedlichsten Genres hervorgebracht. Thomas Quasthoff ist als Sänger sogar mit zwei Grammys ausgezeichnet worden. Er hat die klassische Musik ad acta gelegt und widmet sich jetzt ausschließlich dem Jazz, seiner großen Leidenschaft. Auch Becker kommt vom Jazz. Jeder, der ihn damals im Proberaum im Zooviertel erlebt hat, hat danach vermutlich doppelt so viel geübt, um verzweifelt festzustellen, dass es trotzdem nicht reicht, auch nur annähernd der schwebenden Leichtigkeit von Markus Becker nahe zu kommen. In der Stadt gibt es weitere Ausnahmepianisten: Igor Levit, Elmar Braß, Achim Kück oder Lutz Krajenski spielen in einer eigenen Liga. Im Popmusikbereich der UNESCO City of Music braucht man keine Namen zu nennen; die Assoziationen sind stets präsent. Und jetzt kommt der Ur-Hannoveraner Becker, der durchaus in einem Atemzug mit Lang Lang oder mit Yiruma genannt wird, und ausgerechnet die Institution in Sachen Klassik liefert ein Album ab, mit dem man nicht gerechnet hätte. Und das einem das Lächeln tief ins Gesicht meißelt. Und schließlich: Irgendwo muss man ja geboren worden sein. Niemanden interessiert das außerhalb der betreffenden Stadt. Sängerin Nicole steht im Goldenen Buch der Stadt Saarbrücken, Lena Meyer-Landrut steht im Goldenen Buch von Hannover, Beckers Unterschrift sucht man dort vergebens. So what. Aber:
Was Becker in die Königsklasse von Jarrett, von Michel Petrucciani oder von Dave Grusin hebt, ist die Qualität der Lieder, die in den drei Tagen in Bremen entstanden sind. Auf Jarretts Album sind es vier Stücke, die er stöhnend und schwitzend in der Kölner Oper gespielt hat – auf Beckers „Freistil“ sind es neunzehn! kleine und größere Themen. Was der kleine große Petrucciani oft mit mathematischer Präzision gespielt hat, klingt bei Becker wie eine gelöste Gleichung mit teilweise überraschendem Ergebnis. Wo Grusin Gefahr läuft, seine komplizierten Stücke mit allzu süßem Zuckerguss zu überziehen, achtet Becker darauf, seine akustischen Gedankenhäppchen von vorn herein nicht zu schwer und dadurch ungenießbar werden zu lassen.
Auf dem Klappcover der CD beschreibt Markus Becker selbst seine Arbeit am Klavier und an dem Tonträger, wie es niemand besser hätte tun können. Wer wüsste mehr als der Künstler selbst zu den Stücken zu sagen. Dabei ist er weit entfernt von jeglicher Phrasendrescherei. Das gilt auch für die Musik: Zurückhaltung statt Selbstbeweihräucherung – „Freistil“ zeigt genau das, was geniale Musiker aller Stile und aller Epochen ausmacht: Alles, was man je gelernt hat, unhörbar zu machen und dadurch eine Authentizität zu erreichen, die es verbietet, Können oder Technik oder Schnelligkeit oder Kompositionskunst zu bewerten. Es sind allein die Töne, die zählen. Die Gefühle vermitteln.
Markus Becker sagt sehr persönlich, was er bei den einzelnen Stücken für Assoziationen hatte. Doch beim Hören seiner dahingetupften Melodien entstehen eigene Gefühle, die sehr oft nichts mit den Beckerschen Empfindungen zu tun haben. Ein vermessener Vergleich: Millionen von Beatles-Fans halten deren weißes Album für das beste der Welt. Die Gefühle eines jeden Einzelnen beim Hören der Schallplatte sind trotzdem völlig unterschiedlich. Jegliche Kritik kann demnach nur persönlich sein; es steht dem Rezensenten nicht zu, über instrumentale Fertigkeiten eines Virtuosen zu urteilen. Aber es steht ihm zu, seine Empfindungen und Gedankenketten zu beschreiben. Deswegen das Folgende:
Becker hat sein erstes Stück „Vernissage“ genannt. Mehr Jarrett geht nicht. Man hört Blues, man hört versöhnliche Harmonien, auf dem dunklen Thema liegen spielerische erhellende Singlenotes. Ich denke an eine Leiter, manche Stufen erklimme ich vorsichtig, auf manchen stehe ich sicher. Wohin führt sie?
„Abzählreim“, das zweite Stück, lässt vieles im Unklaren und hört überraschend auf. Zur Versöhnung gibt es danach in „Keller Küche“ ein wenig Gershwin zum Wohlfühlen. Becker gelingt das Kunststück, eine vieltausendmal gehörte Blues-Endphrase durch eine simple Drehung völlig neu klingen zu lassen.
„Nostalgia“ führt mich in ein rosafarbenes Schlafzimmer der 50er Jahre. Wo ist Doris Day, wenn man sie braucht?
„oder so“ – das Stück, das Jazz am Nächsten kommt. Die Vermutung lag nahe, als Becker eine Impro-CD angekündigt hatte, dass es Jazz-Spielereien werden. Nun, Jazz ist das alles nicht, auch wenn die Genre-Definition in den vergangenen Dekaden aufgelockert worden ist. Es ist meditativ, zart, kompliziert und fordert die ganze Konzentration, aber Jazz? Man korrigiere mich, aber: Nein.
„Zwielicht“ – sparsamer Anfang. Vielleicht das aufschlussreichste Lied, denn man hört die gesamte klangliche Bandbreite des Flügels. Oben jubilieren die Perlenketten, unten droht der Bass. Die Vereinigung macht atemlos.
„Kinderszene“ – eindeutig ein Wiegenlied. Hier stimmen meine Gedanken mit denen Beckers überein. Gruß an Robert Schumann.
Bevor ich „Prozession“ gehört habe, habe ich Beckers eigene Beschreibung gelesen. Fehler. Die Bilder, die er in meinen Kopf gepflanzt hat, lassen sich nur schwer wieder löschen. Ich kann bestenfalls meine Assoziation hinzufügen: James Bond, Leben und Sterben lassen. Südstaaten, Voodoo. Ich lasse das mit dem Vorher-Lesen künftig sein.
„Regen Regen“ ist mein persönliches Lieblingsstück. Zunächst war es nur „Lied neun“ im Auto – Sie kennen das. Dann wurde das fragile Stückchen immer eindringlicher. Es soll bitte nie aufhören …
Bei „Paarlauf“ höre ich in den Doppeltönen wieder Keith Jarrett. Becker sagt dazu, er war nie besonders gut auf dem Eis am Pferdeturm. Dafür war er erfolgreich im Knabenchor Hannover. Man kann nicht alles haben.
Becker schreibt über „Spieglein“, dass seine Finger kurz vor dem Verknoten waren. Meine Finger verknoten sich ab und zu schon bei G-Dur. Na und? Mit einem Knoten im Finger geh ich noch lange nicht nach Hause. Hauptsache, die Töne haben die gewünschte Wirkung. Dissonanzen, aber im Gegensatz zu Stockhausen setzt Becker einen Punkt ans Ende, so dass man ausatmen und sich auf „Nachruf“ freuen kann. Becker sagt, er werde versuchen, die improvisierten Harmonien genau heraus zu hören, damit er sie bei seinen Konzerten genau so wiedergeben kann. Ich nehme an, das stellt sein Ensemble vor ziemliche Herausforderungen, denn das Stück ist in Ges-Dur. Und ich denke die ganze Zeit an Silvester. „Should Auld Acquaintance Be Forgot“ …
„Pilotfisch“ ist ein tropfender Wasserhahn. Eiin Klempner fummelt herum und repariert ihn. Ein sehr hibbeliger Klempner …
„Daumenkino“ – verstörend, á la Schönberg, aber es verhindert, dass man in einen sanften Wohlgefühlschlummer fällt.
„Dvořák“ – in Anlehnung an den New York-Aufenthalt des tschechischen Komponisten. Das Stück allerdings klingt wie Südstaaten. Schwül, träge, Mississippi, Ragtime. Und New Orleans ist ja nur 2000 Kilometer von New York entfernt …
Bei „Elchtest“ tut die linke Hand so, als hätte sie nichts zu tun, während die rechte um sie herum scharwenzelt. Dann darf sie doch noch zeigen, das sie mehr kann als Terzen spielen.
„Barcarole“ hat nichts mit Offenbachscher Operette zu tun. Der Titel ist gut gewählt, denn man wähnt sich auf einem Fluss. Wobei der venezianische Gondoliere eher martialisch daher kommt.
„Freistil“ ist zu Recht titelgebend. Was für ein federleichter Tastentanz. Durch winzige Veränderungen schafft Becker den Sprung von scheinbar trivialen Carpenters-Themen zu einem versöhnlichen, leisen, geradezu symphonischen Ende. Er hat – man verzeihe das Wortspiel – mächtig reingehauen. Der Wein ist ausgetrunken, der Teller leer. Aber es kommt ja noch „wieder gut“, das letzte Lied. Könnte von Coldplay oder von Chopin sein. Und da passiert es: Das Thema ist ein Ohrwurm. Was war denn eigentlich schlecht?
Markus Becker hat allein für sich gespielt, in einem Raum, der eine wunderbare Akustik hat. Nicht einmal der Toningenieur Stephan van Wylick war dabei, als Becker am Steinway seine Seele auf die Tasten gelegt hat. Alles ist live. Ja, natürlich. Das können große Pianisten. So geht der Job. Allerdings: Manch einer erinnert sich vielleicht an die meditativen Improvisationen von George Winston auf „Summer“ oder „Winter Into Spring“. Dabei hat der Maestro schnöde geschummelt, wie mir sein ehemaliger Toningenieur Walter Quintus einst bei einer Flasche Rotwein mitteilte. Er hat einfach auf die Schneidekunst seiner Techniker vertraut, die die falschen Töne beim Improvisieren durch richtige ersetzt haben. Nun, zu verpetzen gibt es bei Becker nichts. Akkorde wurden nicht ausgetauscht, Anschlagstärken nicht angepasst. Das könnte die Technik heutzutage. Was Becker gespielt hat, ist eins zu eins auf CD geb(r)annt, ohne dass etwas verändert wurde. Unter dem Strich ist es das Ergebnis von wochenlangem Sichten stundenlangen Spiels, sozusagen ein Best of Becker. Und das ist in der Tat ein Hörerlebnis für die Ewigkeit geworden. Nicht nur für Hannoveraner. John Lennon wurde schließlich auch irgendwo geboren.
INFO: Freistil live: Am Samstag, 26. Oktober, spielt Markus Becker im hannoverschen Sprengel-Museum.
INFO: Freistil live: Am Samstag, 26. Oktober, spielt Markus Becker im hannoverschen Sprengel-Museum.