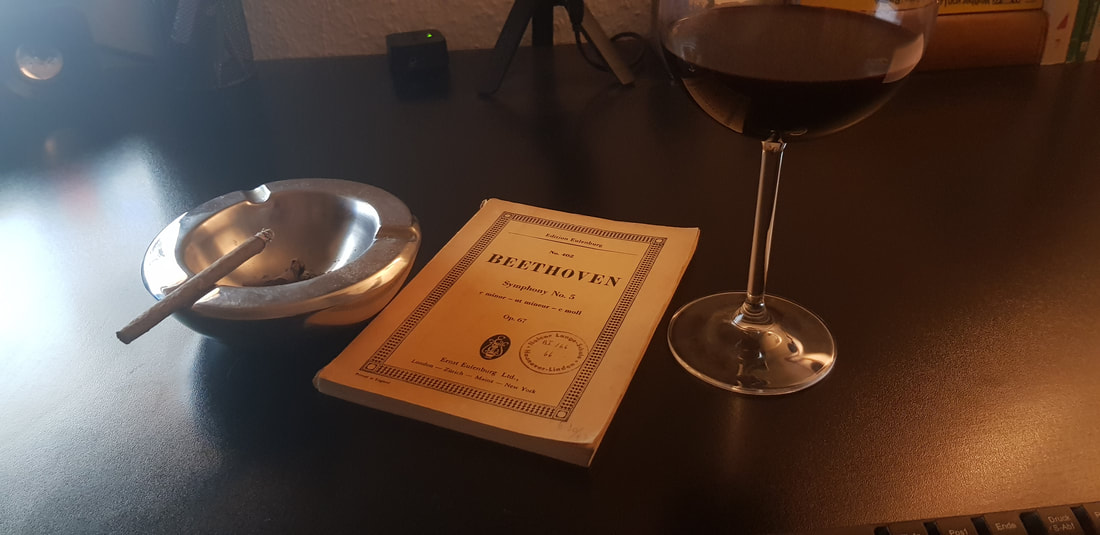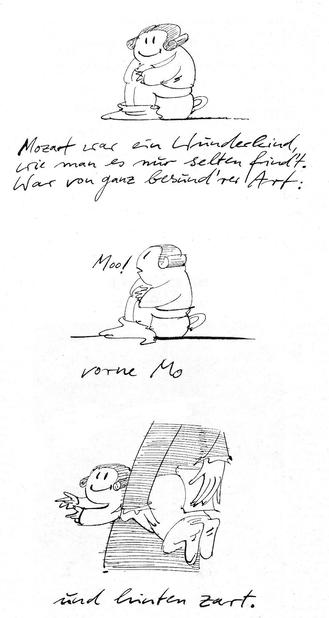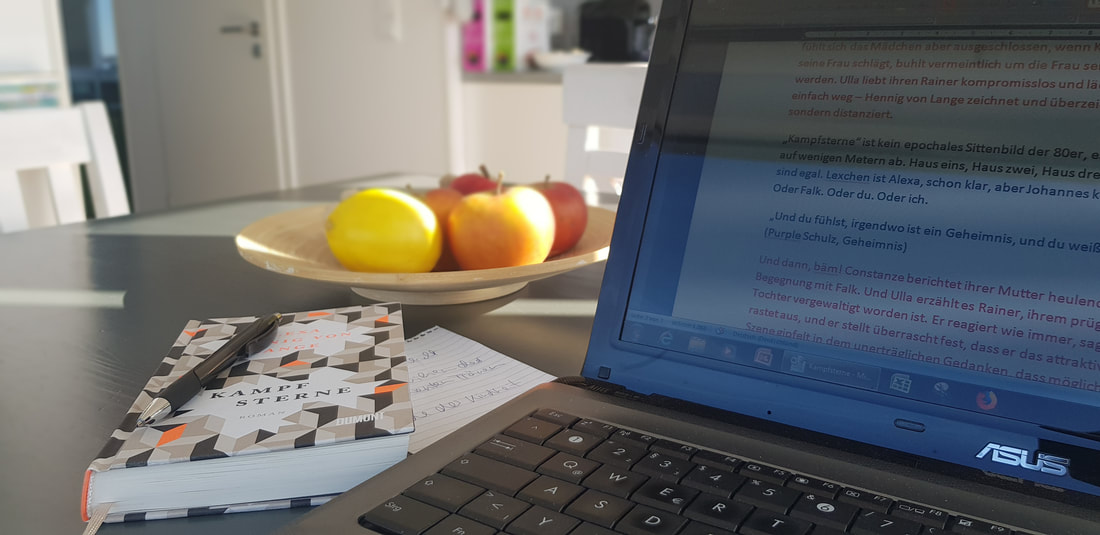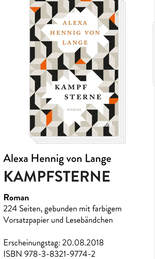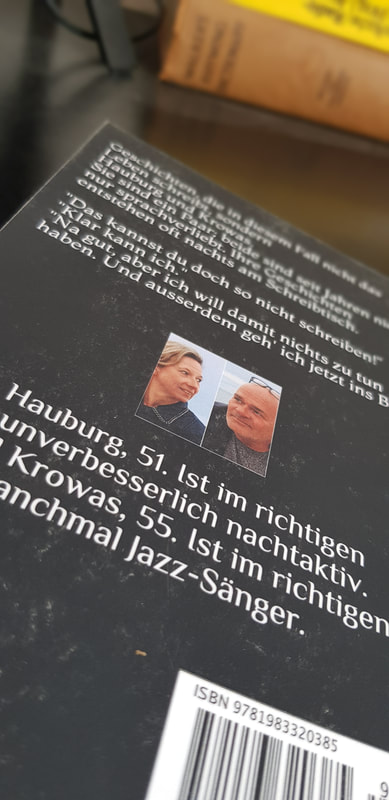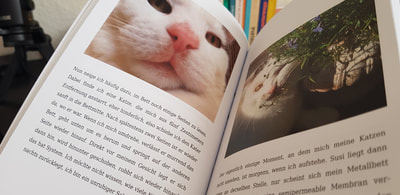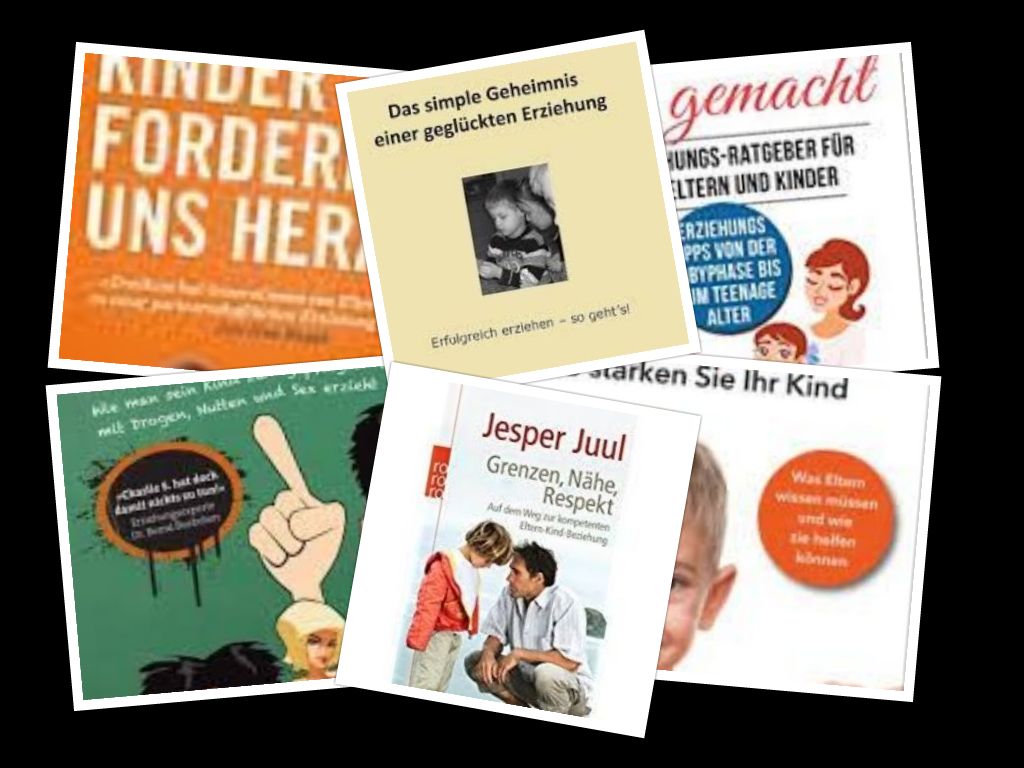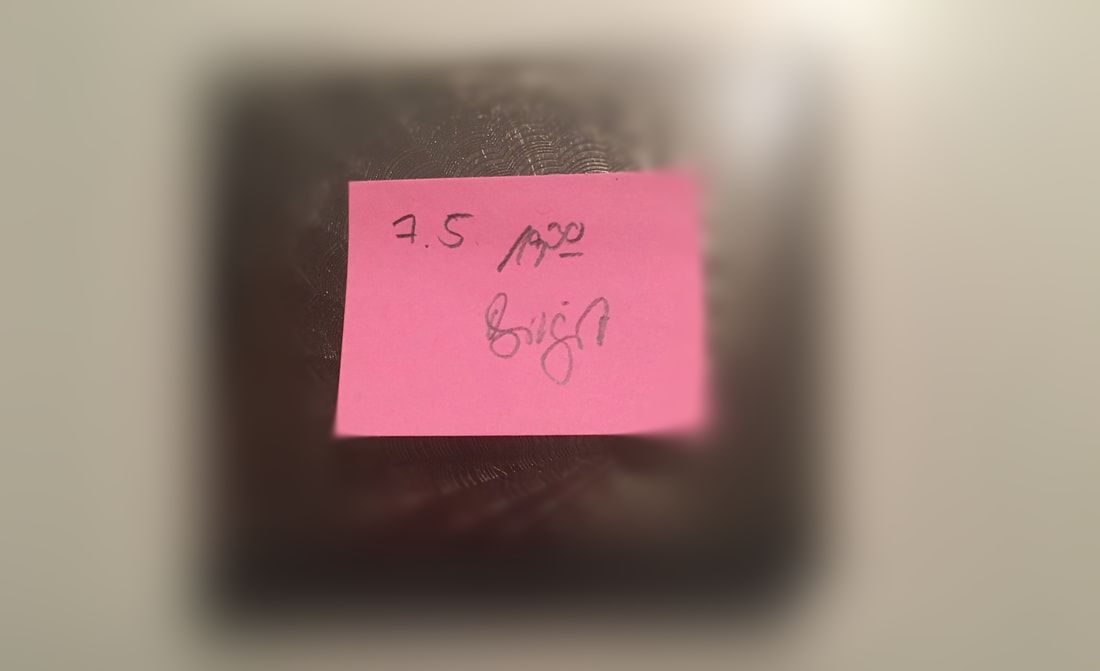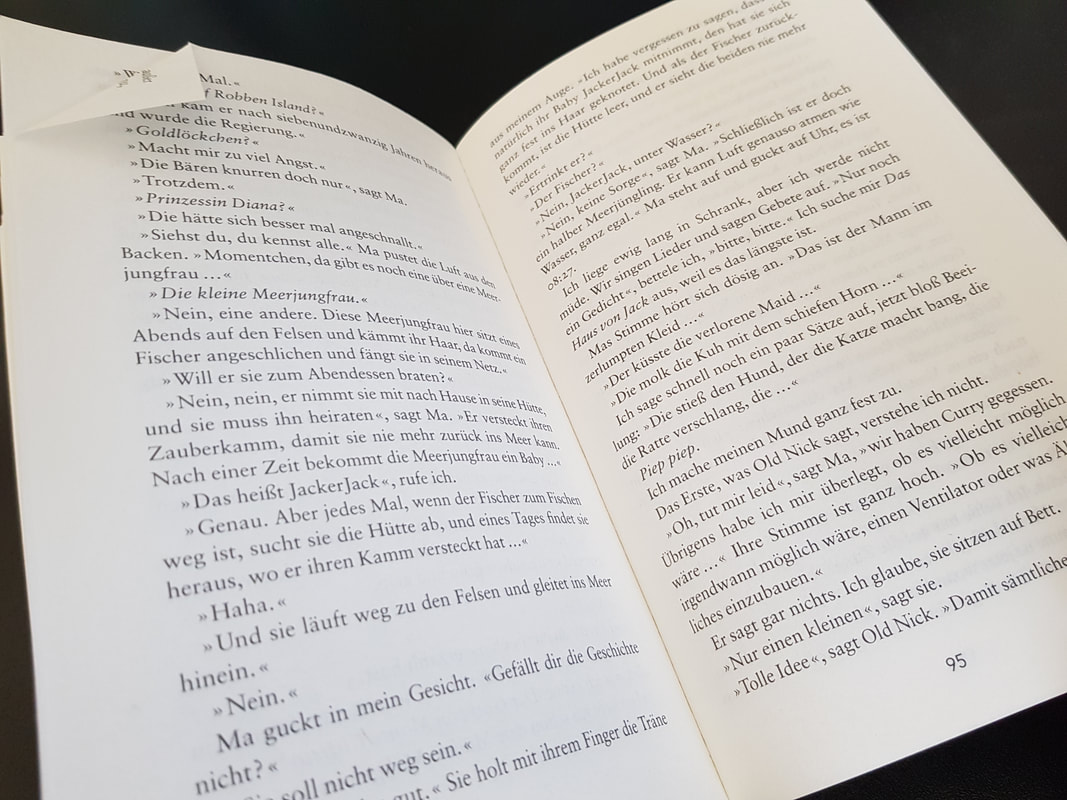Eigentlich habe ich Katzen, seit ich denken kann. Okay, manchmal denke ich nicht oder nicht viel, das gebe ich zu, aber können kann ich es. Meine Katzen waren und sind selbstverständlich immer die tollsten Katzen der Welt – und alle meine Freunde finden das auch. Zumindest behaupten sie das, wenn ich sie direkt darauf anspreche. „Boah, sind Susis Krallenspuren am Sofa kreativ“ oder „nein, wie niedlich sie gerade in die Ecke kackt“…
Alle, bis auf meine Schwester. Sabine war für mich das Paradebeispiel für etwas, das man einen Katzenhasser nennt. „Iiih, wie die haart“ oder „Wehe, die steckt den Kopf in meine Handtasche“ oder „Meine Güte, wie das Katzenklo wieder stinkt“ – derlei Äußerungen verbinde ich kausal mit meiner Schwester. Man konnte sich immer darauf verlassen, dass sie nach einem halbstündigen Besuch in meiner Wohnung anfing zu röcheln: „Ich krieg keine Luft mehr“ und hurtig entschwand.
Seit einiger Zeit ist alles anders. Der Instagram-Account meiner Schwester quillt über vor Bildern von ihren Beinen, auf denen gerade irgendeine Katze herumlungert. Oder sie hält eine dieser Felidae auf dem Arm und lässt sich die Nase ablecken. Welche Mächte da auch immer ihre Hand im Spiel hatten, meine große Schwester ist jetzt offenbar katzenverrückt. Und es ist ihr völlig egal, dass ich seit 35 Jahren mit den Viechern lebe. Nie fragt sie mich um Rat oder um meine Meinung, was die jeweiligen Objekte ihrer Zuneigung angeht, nie, niemals. Ein bisschen sauer macht mich das schon.
Eine gute Freundin von mir kenne ich seit der Schulzeit. Karina positionierte sich damals mehr als deutlich zum Thema Kinder. Wenn die Rede auf Kinder kam, machte sie immer irgendwelche Würgegeräusche oder deutete mit der flachen Hand einen Schnitt durch die Kehle an. „Gut durch“, das war ihre Standardantwort auf die Frage, ob sie denn Kinder möge. Kids suck, das war ihr unumstößliches Motto. Jahrelang.
Wir sind, wie gesagt, heute noch befreundet. Wir telefonieren von Zeit zu Zeit, um uns über unsere gegenseitigen Leben auszutauschen. Karina erzählt dann jedes Mal stolz von Lisa, ihrer Tochter, die Medizin im mittlerweile dritten Semester studiert, und von Phil, ihrem Sohn, der gerade sein Abi baut. „Eins neunzig, ist das zu fassen?“ – womit sie nicht dessen Durchschnittsnote bei der Reifeprüfung meint.
Heute, am Ostersonntag, war ich mit meiner Liebsten, ihrer Tochter und deren Tochter unterwegs. Ich habe natürlich nicht das Recht, mich in Luises Leben einzumischen – ich will nicht riskieren, dass sie mir irgendwann ein verächtliches „Du bist gar nicht mein richtiger Vater, bäh“ entgegen schleudert – aber ich habe mich mehr als deutlich zum Thema Enkelkinder und ich geäußert. „Wer mich je ‚Opa‘ nennt, stirbt“, oder so ähnlich. Ich fühle mich eben nicht wie einer. Einige meiner verflossenen Gefährtinnen hatten auch Kinder, und immer, wenn ich irgendwie meine Meinung geäußert habe, kam unweigerlich dieser Spruch. Trennungsgrund, nicht mehr, nicht weniger. Luise ist da anders. Sie schätzt meine Meinung oder tut zumindest so, und sie weiß, dass ich anfangs missgebilligt habe, dass sie so jung schon Mutter wird. Nun ist es jedoch so, dass ihre winzig kleine Tochter ein ganz zauberhaftes Wesen ist. Wenn sie mit ihren winzig kleinen Händen an meiner Kette zerrt oder mit ihren winzig kleinen Füßen in mein Gesicht tritt, zerfließe ich vor lauter Zuneigung.
Vorhin, beim Frühstück, meinte Luise ernsten Blickes, sie müsse mich jetzt mal etwas fragen. Ich zuckte zusammen. Dass ich kein Geld habe, weiß sie, und meine recht bunte Vergangenheit ist ihr ebenfalls wohlbekannt. Also legte ich meine Stirn in erwartungsvolle Falten. „Sie wird ja jetzt bald anfangen zu sprechen“, sagte Luise über ihre winzig kleine, zauberhafte Tochter, „und ich wollte mal wissen, wie ich dich anteasern soll, wenn wir von dir reden. Krowie, Krowas, Michi, Micha oder Opa?“
Die Stille am Tisch wurde greifbar. Ich runzelte meine Stirn solange, bis ich aussah wie ein Bassett, und murmelte: „Opa ist schon okay“, ganz leise, damit es auch ja niemand hört.
Luise meinte nur, ja, das fände sie auch am besten, und ich stocherte weiter in meinem Rührei herum. Wann, um Himmels willen, ist denn aus mir Misogyn ein gnädiger alter Mann geworden? Ich werde meine Schwester fragen müssen.
Alle, bis auf meine Schwester. Sabine war für mich das Paradebeispiel für etwas, das man einen Katzenhasser nennt. „Iiih, wie die haart“ oder „Wehe, die steckt den Kopf in meine Handtasche“ oder „Meine Güte, wie das Katzenklo wieder stinkt“ – derlei Äußerungen verbinde ich kausal mit meiner Schwester. Man konnte sich immer darauf verlassen, dass sie nach einem halbstündigen Besuch in meiner Wohnung anfing zu röcheln: „Ich krieg keine Luft mehr“ und hurtig entschwand.
Seit einiger Zeit ist alles anders. Der Instagram-Account meiner Schwester quillt über vor Bildern von ihren Beinen, auf denen gerade irgendeine Katze herumlungert. Oder sie hält eine dieser Felidae auf dem Arm und lässt sich die Nase ablecken. Welche Mächte da auch immer ihre Hand im Spiel hatten, meine große Schwester ist jetzt offenbar katzenverrückt. Und es ist ihr völlig egal, dass ich seit 35 Jahren mit den Viechern lebe. Nie fragt sie mich um Rat oder um meine Meinung, was die jeweiligen Objekte ihrer Zuneigung angeht, nie, niemals. Ein bisschen sauer macht mich das schon.
Eine gute Freundin von mir kenne ich seit der Schulzeit. Karina positionierte sich damals mehr als deutlich zum Thema Kinder. Wenn die Rede auf Kinder kam, machte sie immer irgendwelche Würgegeräusche oder deutete mit der flachen Hand einen Schnitt durch die Kehle an. „Gut durch“, das war ihre Standardantwort auf die Frage, ob sie denn Kinder möge. Kids suck, das war ihr unumstößliches Motto. Jahrelang.
Wir sind, wie gesagt, heute noch befreundet. Wir telefonieren von Zeit zu Zeit, um uns über unsere gegenseitigen Leben auszutauschen. Karina erzählt dann jedes Mal stolz von Lisa, ihrer Tochter, die Medizin im mittlerweile dritten Semester studiert, und von Phil, ihrem Sohn, der gerade sein Abi baut. „Eins neunzig, ist das zu fassen?“ – womit sie nicht dessen Durchschnittsnote bei der Reifeprüfung meint.
Heute, am Ostersonntag, war ich mit meiner Liebsten, ihrer Tochter und deren Tochter unterwegs. Ich habe natürlich nicht das Recht, mich in Luises Leben einzumischen – ich will nicht riskieren, dass sie mir irgendwann ein verächtliches „Du bist gar nicht mein richtiger Vater, bäh“ entgegen schleudert – aber ich habe mich mehr als deutlich zum Thema Enkelkinder und ich geäußert. „Wer mich je ‚Opa‘ nennt, stirbt“, oder so ähnlich. Ich fühle mich eben nicht wie einer. Einige meiner verflossenen Gefährtinnen hatten auch Kinder, und immer, wenn ich irgendwie meine Meinung geäußert habe, kam unweigerlich dieser Spruch. Trennungsgrund, nicht mehr, nicht weniger. Luise ist da anders. Sie schätzt meine Meinung oder tut zumindest so, und sie weiß, dass ich anfangs missgebilligt habe, dass sie so jung schon Mutter wird. Nun ist es jedoch so, dass ihre winzig kleine Tochter ein ganz zauberhaftes Wesen ist. Wenn sie mit ihren winzig kleinen Händen an meiner Kette zerrt oder mit ihren winzig kleinen Füßen in mein Gesicht tritt, zerfließe ich vor lauter Zuneigung.
Vorhin, beim Frühstück, meinte Luise ernsten Blickes, sie müsse mich jetzt mal etwas fragen. Ich zuckte zusammen. Dass ich kein Geld habe, weiß sie, und meine recht bunte Vergangenheit ist ihr ebenfalls wohlbekannt. Also legte ich meine Stirn in erwartungsvolle Falten. „Sie wird ja jetzt bald anfangen zu sprechen“, sagte Luise über ihre winzig kleine, zauberhafte Tochter, „und ich wollte mal wissen, wie ich dich anteasern soll, wenn wir von dir reden. Krowie, Krowas, Michi, Micha oder Opa?“
Die Stille am Tisch wurde greifbar. Ich runzelte meine Stirn solange, bis ich aussah wie ein Bassett, und murmelte: „Opa ist schon okay“, ganz leise, damit es auch ja niemand hört.
Luise meinte nur, ja, das fände sie auch am besten, und ich stocherte weiter in meinem Rührei herum. Wann, um Himmels willen, ist denn aus mir Misogyn ein gnädiger alter Mann geworden? Ich werde meine Schwester fragen müssen.